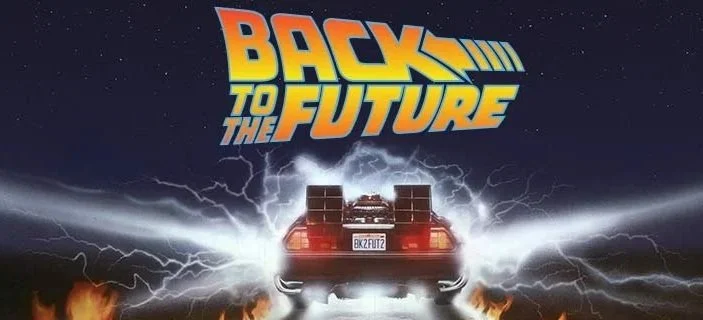Ich bin genau richtig – mit allem, was mich ausmacht
In meinen Anfängen in den sozialen Medien habe ich frei geschrieben so wie der Schnabel gewachsen ist. Ich habe mir keine Gedanken über mein mein äusseres Erscheinungsbild gemacht . So komme ich mir so vor, dass meine Texte wie durch den Laufsteg gehen und von Kunz und Hunz bewertet werden nach ihren äusseren Kriterien, Vergleiche, Unterstellungen wie ich sein sollte - und sie wollen bestimmen - über mein Vorwärtskommen. Als wären sie Gott selbst. Dies war der Anfang einer ungebuchten Reise zu mir selbst.
Heuschreckenplage für penetrante „Hilfe
In den sozialen Medien gibt es unterschiedliche Menschen , die dir Likes, Kommentare und ehrliche Meinungen schenken, sondern auch solche, die dir ständig Verbesserungen und Korrekturen aufdrängen – als wäre das ein Geschenk, auf das du sehnsüchtig gewartet hast. Diese Art von „Hilfe“ zehrt meine Kraft auf und hindert mich daran, wirklich voranzukommen.
Sie zehren meine Kraft auf und helfen mir nicht voranzukommen. Ich bin richtig – genau so, wie ich bin – und brauche diese Art von Hilfe nicht, um „korrekt“ oder anders zu werden. Ich brauche keine ungebetenen Ratschläge von denen, die glauben, das „perfekte Leben“ zu kennen.
Manchmal sind sie jedoch so penetrant wie eine Heuschreckenplage, die sich in meine vermeintlichen Schwächen einnisten möchte. Ich liebe mein Sein – meine individuelle Art, meine Ideen, und meine neurodivergente Sichtweise. Und ja, auch das gelegentliche Stolpern gehört zu mir.
Heuschreckenplage für penetrante „Hilfe
Neurodivergenz: Einzigartig statt Massenware
Denn ich brauche sie nicht. Ich will kein linearer Mensch werden. So wie lineare Menschen mit mir klarkommen müssen, muss auch ich mit ihnen klarkommen. Ihr Verhalten bringt mich manchmal zur Verzweiflung – doch es käme mir nie in den Sinn, sie zu korrigieren, zu bewerten oder mich als überlegen darzustellen. Es geht nicht darum, sich zu verbiegen oder anzupassen, sondern darum, zu erkennen, was uns verbindet. Ich bin keine Massenware – sondern etwas Einzigartiges.
Gemeinsam können wir Wege finden, Unterschiede nicht als Fronten, sondern als Spannungsfelder zu sehen, in denen Neues entstehen kann: Offenheit, frische Ideen und gemeinsame Lösungen. So wird das Leben für alle leichter – denn wir verändern nicht Menschen, sondern Systeme.
Neurodivergente Menschen haben Gehirne, die anders funktionieren als die neurotypische Mehrheit. Sie nehmen Informationen und Reize anders wahr und verarbeiten sie auf besondere Weise. Das zeigt sich im Denken, Lernen, Wahrnehmen sowie in Aufmerksamkeit, Impulskontrolle und sensorischer Verarbeitung.
Die neurologischen Unterschiede bringen besondere Stärken und Herausforderungen mit sich – doch letztlich ist kein Mensch vollkommen.
Stärken und Herausforderungen neurodivergenter Menschen
(ADHS, Legasthenie, Asperger, etc.):
Stärken und Herausforderungen neurodivergentes Verhalten
Soziale Medien: Wenn Hightech auf Mittelalter-Denken trifft
Soziale Medien: Wenn Hightech auf Mittelalter-Denken trifft
Und manchmal fühlt es sich für mich an, als würde mich das Netz in eine längst vergangene Zeit zurückkatapultieren: Wie in einem alten Film stehe ich wieder genau dort, wo ich vor einem halben Jahrhundert stand – im Klassenzimmer – als neurodivergente Schülerin, die von ihrem Klassenlehrer stigmatisiert, beschämt und vor der Klasse an den Pranger gestellt wurde. Meine Schwächen wurden zur Zielscheibe – für Entwertung und Dominanz. Er vermittelte mir nicht nur Wissen, sondern prägte mir auch meinen gesellschaftlichen Wert ein – tief in mir gebrandmarkt, wie eine Marke, die bestimmte Normen und Erwartungen von mir verlangte - die ich meinte, über die ich verfügen muss, um dazugehören
Gesellschaftliche Zuschreibungen und Intersektionalität
Neurodivergente Menschen werden von der Gesellschaft häufig stigmatisiert, ausgegrenzt oder als „gestört“ angesehen – und leider hält sich diese veraltete Sichtweise bis heute in vielen Köpfen.
Viele tragen den inneren Schmerz aus ihrer Kindheit mit sich und versuchen, diesen durch Selbstoptimierung und das Erfüllen äusserer Anforderungen zu überspielen. Sie strengen sich unermüdlich an, „besser“ zu werden, um Anerkennung zu erhalten – ohne zu erkennen, dass sie längst genug sind.
So verstehen viele nicht, wie ich lange Zeit auch nicht, , dass die tief verinnerlichten gesellschaftlichen Rollenzuschreibungen, an die sie glauben, längst überholt und eine falsche Vorstellung darstellen - nicht ihrer authentischen Identität entsprechen. Intersektionalität, ein Konzept geprägt von Kimberlé Crenshaw, zeigt, wie verschiedene Formen von Diskriminierung und Unterdrückung – Identitäten oder Merkmale (Geschlecht, ethnische Herkunft, soziale Klasse, Behinderung, sexuelle Orientierung – sich überschneiden und miteinander verwoben sind. Die Erfahrungen von Menschen mit neurodivergentem Denken lassen sich nicht isoliert betrachten, sondern müssen im Kontext ihrer vielfältigen Identitäten und gesellschaftlichen Zuschreibungen verstanden werden. So wie bestimmten Gruppen bestimmte Verhaltensweisen oder Merkmale zugeschrieben werden, kann auch neurodivergentes Denken mit Vorurteilen, Stereotypen und Stigmata belastet sein. Dabei sind diese Menschen bereits mit ihrem Sein gut genug. Ihre Aufgabe ist nicht, sich ständig zu verbessern, um Erwartungen anderer zu erfüllen, sondern sich selbst zu werden, zu akzeptieren, wie sie sind. Aus dieser Selbstakzeptanz heraus kann echte Weiterentwicklung entstehen – nicht durch äusseren Druck und fremde Erwartungen von aussen, sondern aus dem eigenen, tiefen Wunsch, sich zu entfalten und den eigenen Horizont zu erweitern.
Was bringt Wachstum? Menschen welche sich durch äusseren Druck oder aus einer inneren gewollten Motivation heraus?
Das Konzept der Intersektionalität von Kimberlé Crenshaw richtet den Blick darauf, wie Rassismus, Patriarchat, Klassenzugehörigkeit und andere Unterdrückungssysteme oft unsichtbare Ungleichheiten schaffen, die insbesondere die Beziehungen von Frauen zu Kategorien wie Rasse, Ethnie und Klasse prägen. Außerdem thematisiert es konkrete Handlungen und politische Strukturen, die Frauen belasten und entlang dieser Achsen zur Entmachtung und zum Verlust von Selbstbestimmung führen.
Meine innere Reise: Ballast abwerfen und Selbstachtung gewinnen
Dass ich heute so denken kann, wie ich es tue, ist das Ergebnis einer tiefen persönlichen Niederlage, eines emotionalen Zusammenbruchs und einer langen, reflektierten Reise zu mir selbst.
Ich wollte die gesellschaftlichen Zuschreibungen und ständigen Anpassungen, die mir auferlegt wurden verstehen und nicht länger als Teil meines Lebens akzeptieren. Dabei wollte ich niemandem Schuld geben oder Forderungen stellen, wie andere mit mir umgehen sollten. Vielmehr erkannte ich, dass meine innere Abwertung und die Fremdabwertung ein komplexes Zusammenspiel bilden, das mich kontrolliert – ein Mechanismus, über den ich keine Macht hatte, der mich seit Jahrzehnten unsichtbar steuert. Mein Ziel war es, genau diesen Mechanismus zu verstehen und zu durchbrechen. Denn „diese innere Kraft wirkt durch die Verinnerlichung von negativen Zuschreibungen und beeinträchtigt mein Selbstbild.“ (Erving Goffman) – ein klassisches Beispiel für Techniken der Bewältigung beschädigter Identität.
Ich wollte nicht zurückschlagen, sondern verstehen – nicht innerlich gelähmt und gefangen im Gedankenkarussell voller Selbstzweifel und erstarrt in Selbstabwertung. Ich wollte mich von äußerer Kontrolle lösen – von Macht, Pflichtgefühl, Loyalität und Gehorsam, die mir als Mechanismen eingepflanzt wurden, um mich zu steuern, als sei ich ein dressierter Affe. Ich fühlte mich gelähmt im Schmerz meines Seins.
Der Gehorsame gibt sein Selbst auf, um geliebt zu werden. Er opfert seine Authentizität, um nicht verlassen zu werden Arno Grün
Die Zuschreibungen begründen oft asymmetrische Machtverhältnisse, bei denen die ‚stärkeren‘ Gruppen oder Individuen soziale, ökonomische oder psychologische Überlegenheit nutzen , um ihre Position zu sichern und die Schwächeren zu kontrollieren. Als Legastheniker bin ich mir bewusst, was ich im aussen teile und will nicht nach meinen Äusserlichkeiten reduziert werden, sondern ich will über den Inhalt mich austauschen. Doch in den sozialen Medien musste ich zuerst lernen was es heisst sichtbar zu werden, welche Strategien mein Sein schützen, und wie ich mich fokussieren kann auf den Inhalt.
Wie Aschenputtel habe ich mir einen Filter eingebaut:
Die Guten ins Töpfchen, die Bösen ins Kröpfchen.Der wertvolle Inhalt lässt mich wachsen,
die äußeren Bewertungen versinken im digitalen Datenmeer.
Ich weiß nicht, was schwieriger ist: das Fachwissen zu erlernen – oder durch meine Verletzlichkeit und Sensibilität hindurchzugehen, durch die gesellschaftlichen Zuschreibungen und verinnerlichten Hürden, ohne nach links und rechts zu schauen, und einfach meine Gedanken und mein Fachwissen für die weite Welt loszulassen.
Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit."
— Viktor E. Frankl, Psychiater und Begründer der Logotherapie
Wie gehst du mit solchen Situationen um?
Stellst du deine Gefühle einfach ab, um nicht auf äußere Impulse zu reagieren? Oder hast du Wege gefunden, deine Emotionen zu bändigen, damit sie dich nicht auffressen?
Ich lade dich ein, deine Erfahrungen und Strategien zu teilen – denn genau dieser Austausch macht uns stärker.